Hören: Unter dem Titel „Biggy Hamburg Pop“ habe ich eine Playlist mit Songs aus der Hansestadt zusammengestellt. Bandbreite und Beats, brachial und beautiful.
Lesen: Im Frühjahr 2018 kursierte auf Facebook die Aufgabe, zehn Platten zu benennen, die einen nachhaltig beeinflusst haben – unabhängig von musikhistorischer Relevanz. Zu den jeweiligen Alben habe ich biografische Notizen verfasst. Für mich eine schöne Erinnerung daran, wie individuell prägend Musik ist.
1: „Nena“ von Nena
 Meine erste Langspielplatte. 1983. Dritte, vierte Klasse. Ich wollte sein wie Nena und war zugleich total verknallt in sie. Ich klebte ihr Poster an meine Wolkentapete und bewunderte, wie ihr die Ponyfransen in die Stirn fallen. Der erste Song poppte und quietschte und rumpelte bereits so schön wild. Und sollte eine weitere Leidenschaft anfachen. „Um Mitternacht sitz‘ ich im Kino. Ich seh mir alles an“. Das mit der Mitternacht kam erst später. Ich schaute nachmittags mit meinem Vater und meinem Bruder „E.T.“ und Filme mit Bud Spencer und Terence Hill. Groß und magisch und auf die Zwölf. Kurz darauf kam ich aufs Gymnasium. Daniel aus meiner Lateinklasse sah aus wie Dave Gahan von Depeche Mode. Für mich gehörte das alles zusammen: die Keyboards, der Rhythmus, das Pathos. People are people.
Meine erste Langspielplatte. 1983. Dritte, vierte Klasse. Ich wollte sein wie Nena und war zugleich total verknallt in sie. Ich klebte ihr Poster an meine Wolkentapete und bewunderte, wie ihr die Ponyfransen in die Stirn fallen. Der erste Song poppte und quietschte und rumpelte bereits so schön wild. Und sollte eine weitere Leidenschaft anfachen. „Um Mitternacht sitz‘ ich im Kino. Ich seh mir alles an“. Das mit der Mitternacht kam erst später. Ich schaute nachmittags mit meinem Vater und meinem Bruder „E.T.“ und Filme mit Bud Spencer und Terence Hill. Groß und magisch und auf die Zwölf. Kurz darauf kam ich aufs Gymnasium. Daniel aus meiner Lateinklasse sah aus wie Dave Gahan von Depeche Mode. Für mich gehörte das alles zusammen: die Keyboards, der Rhythmus, das Pathos. People are people.
2: „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ von The Beatles
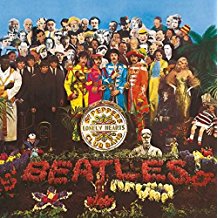 Mit 13, 14 sah ich im Fernsehen eine Doku zum Beatles-Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“. Die catchy Songs, aber auch das bonbonbunte Cover mit seinem aufregenden Personal faszinierten mich total. Die Nummer „She’s Leaving Home“ erinnerte mich daran, dass ich mit meiner Grundschul-Freundin Sandra gerne „Ausreißen“ gespielt hatte. Wir hatten unser Bündel mit Vorräten geschnürt, hatten auf dem nahe gelegenen Feld gepicknickt und waren abends nach Hause zurückgekehrt. Parallel zu meiner großen Fab-Four-Boygroup-Liebe startete mein drei Jahre älterer Bruder nun in die Hochphase seines Mod-Daseins, grandios eingefangen vom guten Tobi Dahmen in seinem Carlsen-Comic „Fahrradmod“. Die wilden Jungs saßen auf unserem Dachboden, hörten Platten und tranken Malzbier, bis mein Vater „Finito“ rief. Vorher und nachher mussten sie alle an meinem Zimmer vorbei. Jeden Tag Subkultur-Schau. Herrlich. Einer der Freunde meines Bruders hatte Wind von meiner neuen Beatles-Liebe bekommen und machte mir ein Mix-Tape. Ich kaufte mir second hand eine Wildlederjacke, deren Innenfutter zusehends zerfiel, und verweigerte mich der Tanzschule. Too cool for school.
Mit 13, 14 sah ich im Fernsehen eine Doku zum Beatles-Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“. Die catchy Songs, aber auch das bonbonbunte Cover mit seinem aufregenden Personal faszinierten mich total. Die Nummer „She’s Leaving Home“ erinnerte mich daran, dass ich mit meiner Grundschul-Freundin Sandra gerne „Ausreißen“ gespielt hatte. Wir hatten unser Bündel mit Vorräten geschnürt, hatten auf dem nahe gelegenen Feld gepicknickt und waren abends nach Hause zurückgekehrt. Parallel zu meiner großen Fab-Four-Boygroup-Liebe startete mein drei Jahre älterer Bruder nun in die Hochphase seines Mod-Daseins, grandios eingefangen vom guten Tobi Dahmen in seinem Carlsen-Comic „Fahrradmod“. Die wilden Jungs saßen auf unserem Dachboden, hörten Platten und tranken Malzbier, bis mein Vater „Finito“ rief. Vorher und nachher mussten sie alle an meinem Zimmer vorbei. Jeden Tag Subkultur-Schau. Herrlich. Einer der Freunde meines Bruders hatte Wind von meiner neuen Beatles-Liebe bekommen und machte mir ein Mix-Tape. Ich kaufte mir second hand eine Wildlederjacke, deren Innenfutter zusehends zerfiel, und verweigerte mich der Tanzschule. Too cool for school.
3: „Nevermind“ von Nirvana
 Als Nirvanas „Nevermind“ herauskam, war ich 17. Das Video zu „Smells Like Teen Spirit“ lief im Musikfernsehen rauf und runter. Zuerst hatte mich die Nummer mit ihren Anarcho-Cheerleadern nicht so umgehauen. Doch dann tanzte ich zum ersten Mal im Allegro dazu, der Disco unserer Kreisstadt, zu der wir am Wochenende sieben, acht Kilometer mit dem Rad fuhren, mitunter auf dem Gepäckträger, eine Flasche Kellergeister in der Hand. Etwas packte mich. Der Song erschloss sich übers Ausrasten, nicht übers reine Hören. Dem dortigen DJ, Armen, sollte ich fortan immer länger werdende Listen diktieren mit Liedern, zu denen es sich gut durchdrehen ließ. In dem anderen Lieblingsladen, dem Rolling Stone am Rande des Ruhrgebiets, war der DJ, Timo, mutig genug, auch das härteste und schnellste Stück von „Nevermind“ zu spielen. „Territorial Pissings“. Meist hatte ich noch Montagmorgen in der Schule Nackenschmerzen vom Headbangen.
Als Nirvanas „Nevermind“ herauskam, war ich 17. Das Video zu „Smells Like Teen Spirit“ lief im Musikfernsehen rauf und runter. Zuerst hatte mich die Nummer mit ihren Anarcho-Cheerleadern nicht so umgehauen. Doch dann tanzte ich zum ersten Mal im Allegro dazu, der Disco unserer Kreisstadt, zu der wir am Wochenende sieben, acht Kilometer mit dem Rad fuhren, mitunter auf dem Gepäckträger, eine Flasche Kellergeister in der Hand. Etwas packte mich. Der Song erschloss sich übers Ausrasten, nicht übers reine Hören. Dem dortigen DJ, Armen, sollte ich fortan immer länger werdende Listen diktieren mit Liedern, zu denen es sich gut durchdrehen ließ. In dem anderen Lieblingsladen, dem Rolling Stone am Rande des Ruhrgebiets, war der DJ, Timo, mutig genug, auch das härteste und schnellste Stück von „Nevermind“ zu spielen. „Territorial Pissings“. Meist hatte ich noch Montagmorgen in der Schule Nackenschmerzen vom Headbangen.
4: „In Echt“ von Die Sterne
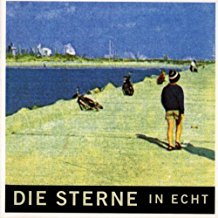 Im Sommer 1994, ich war 20, hing ich mit meinem Bruder vorm Musikfernsehen ab, als ich das erste Mal das Video zu „Universal Tellerwäscher“ von Die Sterne sah. „Was sind denn das für kaputte Typen?“, fragte mein Bruder. Ich war hingerissen. Zahnlücke und Groove und zu kurze Hosen und spröde Poesie. Ich ging am nächsten Tag sofort zu Elpi, dem Plattenladen in der Innenstadt, und fragte den Verkäufer, Mario, nach dem Album „In echt“, auf dem diese tolle Nummer drauf sein sollte. Er strahlte mich an, als hätte ich ein mirakulöses Zauberwort genannt. „Du bist die zweite Person, die diese Platte hier kauft“, sagte er verschwörerisch. Und: „Es gibt noch viel mehr Musik in die Richtung. Soll ich Dir mal was leihen?“ Was leihen. Mario war vermutlich der ineffizienteste Plattenverkäufer des Universums. Tage später, als ich wieder zu Elpi ging, griff er unter die Ladentheke und überreichte mir eine Tüte mit Blumfeld, Die Regierung, Die Braut Haut Ins Auge, Lassie Singers. Ich überspielte die Platten auf Kassetten und nahm die Aufnahmen mit zum Studium in Süddeutschland. Mein Schatz. Eine Eröffnung.
Im Sommer 1994, ich war 20, hing ich mit meinem Bruder vorm Musikfernsehen ab, als ich das erste Mal das Video zu „Universal Tellerwäscher“ von Die Sterne sah. „Was sind denn das für kaputte Typen?“, fragte mein Bruder. Ich war hingerissen. Zahnlücke und Groove und zu kurze Hosen und spröde Poesie. Ich ging am nächsten Tag sofort zu Elpi, dem Plattenladen in der Innenstadt, und fragte den Verkäufer, Mario, nach dem Album „In echt“, auf dem diese tolle Nummer drauf sein sollte. Er strahlte mich an, als hätte ich ein mirakulöses Zauberwort genannt. „Du bist die zweite Person, die diese Platte hier kauft“, sagte er verschwörerisch. Und: „Es gibt noch viel mehr Musik in die Richtung. Soll ich Dir mal was leihen?“ Was leihen. Mario war vermutlich der ineffizienteste Plattenverkäufer des Universums. Tage später, als ich wieder zu Elpi ging, griff er unter die Ladentheke und überreichte mir eine Tüte mit Blumfeld, Die Regierung, Die Braut Haut Ins Auge, Lassie Singers. Ich überspielte die Platten auf Kassetten und nahm die Aufnahmen mit zum Studium in Süddeutschland. Mein Schatz. Eine Eröffnung.
5: „L’Etat Et Moi“ von Blumfeld
 Im November 1994 begann ich mein Studium in Bamberg. Ein Ort, den ich erst einmal auf der Deutschlandkarte nachgucken musste, als ich an der dortigen Uni angenommen worden war. Ich hatte mir vorab im Hauruckverfahren an einem Wochenende ein WG-Zimmer gesichert und wohnte mit einer ruhigen Lehramtsstudentin zusammen sowie mit einer BWLerin, die im Nachbarzimmer lautstark mit ihrem BWLer-Freund stritt. Sie wollte, dass er mehr lernt. Ich hatte brachial schlechte Laune in diesem Winter. Jeden Morgen radelte ich los mit dem Walkman auf den Ohren. Jeden Tag hörte ich die „L’Etat Et Moi“ von Blumfeld. Jedes Mal ertönte als erstes „Draußen auf Kaution“. Das „Apocalypse Now“-artige Hubschraubergeräusch am Anfang passte in seiner Beklemmung perfekt in popkulturelle Diaspora und enge Spießigkeit. Dann Wut mit „Jet Set“. Trost von „Walkie Talkie“. Und natürlich „Verstärker“. Ein schroffer Schub, eine ernsthafte Stimme. Eine Platte, um nicht zu ex- oder zu implodieren.
Im November 1994 begann ich mein Studium in Bamberg. Ein Ort, den ich erst einmal auf der Deutschlandkarte nachgucken musste, als ich an der dortigen Uni angenommen worden war. Ich hatte mir vorab im Hauruckverfahren an einem Wochenende ein WG-Zimmer gesichert und wohnte mit einer ruhigen Lehramtsstudentin zusammen sowie mit einer BWLerin, die im Nachbarzimmer lautstark mit ihrem BWLer-Freund stritt. Sie wollte, dass er mehr lernt. Ich hatte brachial schlechte Laune in diesem Winter. Jeden Morgen radelte ich los mit dem Walkman auf den Ohren. Jeden Tag hörte ich die „L’Etat Et Moi“ von Blumfeld. Jedes Mal ertönte als erstes „Draußen auf Kaution“. Das „Apocalypse Now“-artige Hubschraubergeräusch am Anfang passte in seiner Beklemmung perfekt in popkulturelle Diaspora und enge Spießigkeit. Dann Wut mit „Jet Set“. Trost von „Walkie Talkie“. Und natürlich „Verstärker“. Ein schroffer Schub, eine ernsthafte Stimme. Eine Platte, um nicht zu ex- oder zu implodieren.
6: „Digital Ist Besser“ von Tocotronic
 Im Sommer 1995 war alles viel besser als im Winter davor. Ich war in eine WG mit Stuckdecke und Gleichgesinnten gezogen. Ich war noch immer sehr grüblerisch, trank Rotwein in heißen Nächten und schrieb am offenen Fenster lange Briefe. Doch donnerstags, da gingen wir in unserem fränkischen Studienort immer in den Jazzkeller. Weil dort Indie lief. Auch „Letztes Jahr im Sommer“ von Tocotronic. Rock so unfertig wie man selbst. Das Album „Digital ist besser“ sollte meine Hamburg-Liebe weiter beflügeln. Da wollte ich hin, wo die schlonzingen Leute wohnen. Bis es so weit war, genoss ich den „Sommer der 1000 Eseleien“, wie ein Freund ihn nannte. Meine Freundin Julia und ich legten uns, verschwitzt nach einem Jazzkeller-Besuch, in die noch immer vom Tag warme Gasse. Ein Rad fuhr über unsere langen Haare. Wir schrieen vor Vergnügen. Jemand kippte einen Eimer Wasser aus einem der nahen Häuser, traf uns aber nicht. Ich sollte in den kommenden Monaten viel Musik aus dem Mailorder-Katalog von L’Age D’Or bestellen. Mit der winzigsten Schriftgröße in der Geschichte des Versandhandels. Larger than life.
Im Sommer 1995 war alles viel besser als im Winter davor. Ich war in eine WG mit Stuckdecke und Gleichgesinnten gezogen. Ich war noch immer sehr grüblerisch, trank Rotwein in heißen Nächten und schrieb am offenen Fenster lange Briefe. Doch donnerstags, da gingen wir in unserem fränkischen Studienort immer in den Jazzkeller. Weil dort Indie lief. Auch „Letztes Jahr im Sommer“ von Tocotronic. Rock so unfertig wie man selbst. Das Album „Digital ist besser“ sollte meine Hamburg-Liebe weiter beflügeln. Da wollte ich hin, wo die schlonzingen Leute wohnen. Bis es so weit war, genoss ich den „Sommer der 1000 Eseleien“, wie ein Freund ihn nannte. Meine Freundin Julia und ich legten uns, verschwitzt nach einem Jazzkeller-Besuch, in die noch immer vom Tag warme Gasse. Ein Rad fuhr über unsere langen Haare. Wir schrieen vor Vergnügen. Jemand kippte einen Eimer Wasser aus einem der nahen Häuser, traf uns aber nicht. Ich sollte in den kommenden Monaten viel Musik aus dem Mailorder-Katalog von L’Age D’Or bestellen. Mit der winzigsten Schriftgröße in der Geschichte des Versandhandels. Larger than life.
7: „Different Class“ von Pulp
 1997 war es endlich so weit. Ich zog nach Hamburg. Spröde Schatzstadt. Subkulturelles Stromerland. Meinen Soundtrack dazu lieferte unter anderem die „Different Class“ von Pulp, erschienen im Herbst 1995. So hatte ich es mir vorgestellt. Eine eigene Gesellschaft mit eigener Moral. Wo die Menschen mit den schönen, schrulligen, exaltierten Tanzstilen regierten. So wie es in meinem Freundeskreis das Adjektiv „tocotronisch“ gab, existierte bald das Wort „jarvesk“. Nach Sänger Jarvis Cocker. Für alles Elegant-Verschrobene. Für theatrales Augenrollen. Für all die Peinlichkeiten, die er für uns besang. Ich ging viel aus. Wen ich wann wo kennenlernte zwischen Kir, Pudel und Molotow, zwischen Britpop, Rock und Soul, verschwimmt mitunter in der Erinnerung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich Tanja und Barbara das erste Mal auf einer Privatparty in der Talstraße traf. Ich war nicht eingeladen. Viele andere ebenfalls nicht. Alle kamen. Und kletterten durchs offene Fenster auf ein Baugerüst vor dem Haus, um das irgendwo organisierte Bier auf einem wackeligen Holzbrett zu trinken. Der Kiez unten als Grundrauschen. Gut zwei Jahre später feierten wir um die Ecke, im Blauen Peter, ins neue Millenium. Ich hatte mir „Disco 2000“ mit Filzstift auf mein T-Shirt gemalt. Was sonst.
1997 war es endlich so weit. Ich zog nach Hamburg. Spröde Schatzstadt. Subkulturelles Stromerland. Meinen Soundtrack dazu lieferte unter anderem die „Different Class“ von Pulp, erschienen im Herbst 1995. So hatte ich es mir vorgestellt. Eine eigene Gesellschaft mit eigener Moral. Wo die Menschen mit den schönen, schrulligen, exaltierten Tanzstilen regierten. So wie es in meinem Freundeskreis das Adjektiv „tocotronisch“ gab, existierte bald das Wort „jarvesk“. Nach Sänger Jarvis Cocker. Für alles Elegant-Verschrobene. Für theatrales Augenrollen. Für all die Peinlichkeiten, die er für uns besang. Ich ging viel aus. Wen ich wann wo kennenlernte zwischen Kir, Pudel und Molotow, zwischen Britpop, Rock und Soul, verschwimmt mitunter in der Erinnerung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich Tanja und Barbara das erste Mal auf einer Privatparty in der Talstraße traf. Ich war nicht eingeladen. Viele andere ebenfalls nicht. Alle kamen. Und kletterten durchs offene Fenster auf ein Baugerüst vor dem Haus, um das irgendwo organisierte Bier auf einem wackeligen Holzbrett zu trinken. Der Kiez unten als Grundrauschen. Gut zwei Jahre später feierten wir um die Ecke, im Blauen Peter, ins neue Millenium. Ich hatte mir „Disco 2000“ mit Filzstift auf mein T-Shirt gemalt. Was sonst.
8: „The Miseducation Of Lauryn Hill“ von Lauryn Hill
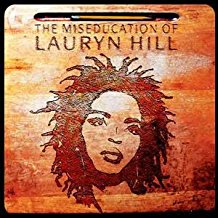 1999 dachte ich: Ich muss unbedingt nach New York. Mein Großonkel Heinrich – Kriegsheimkehrer, Einzelgänger und Zeit seines Lebens äußerst sparsam – war hoch betagt gestorben und wir hatten einen fünfstelligen Betrag unter seinem Bett gefunden. Ich bekam einen Teil des Matratzengeldes, was ich sofort in meine große Reise investierte. Immerhin sollte ein Bett in einem Viererzimmer im Hostel in Chelsea 55 Dollars die Nacht kosten. Von dort aus lief ich los. Die Häuser hoch, die Sonne höher. Durch die Straßen von Manhattan. Was mir bis heute das Liebste ist. Sich einfach verlieren im Sound der Stadt. Am ersten Tag kaufte ich von einem Händler, der seine Ware auf dem Bürgersteig anbot, eine Kassette. „The Miseducation Of Lauryn Hill“, ein Jahr zuvor erschienen. Ich legte das Tape direkt in meinen Walkman. Musik, die den Gang stolzer und federnder macht. „Yo Hip Hop started out in the heart“. Ich fühlte mich unfassbar cool und frei und im Fluss. Lower Eastside, Washington Square Park, Broadway, Central Park, Harlem. Walk and listen, dance and glow. Lauryns Stimme trug mich. New York lud mich mit Energie auf. Tagsüber erlief ich mir vor Glück fast platzend alleine die Stadt. Nachts ging ich mit Leuten aus, die ich im Hostel kennengelernt hatte. Und jedes Mal, wenn ich ein teures Bier für fünf Dollar in einer Bar trank, prostete ich Onkel Heinrich kurz zu.
1999 dachte ich: Ich muss unbedingt nach New York. Mein Großonkel Heinrich – Kriegsheimkehrer, Einzelgänger und Zeit seines Lebens äußerst sparsam – war hoch betagt gestorben und wir hatten einen fünfstelligen Betrag unter seinem Bett gefunden. Ich bekam einen Teil des Matratzengeldes, was ich sofort in meine große Reise investierte. Immerhin sollte ein Bett in einem Viererzimmer im Hostel in Chelsea 55 Dollars die Nacht kosten. Von dort aus lief ich los. Die Häuser hoch, die Sonne höher. Durch die Straßen von Manhattan. Was mir bis heute das Liebste ist. Sich einfach verlieren im Sound der Stadt. Am ersten Tag kaufte ich von einem Händler, der seine Ware auf dem Bürgersteig anbot, eine Kassette. „The Miseducation Of Lauryn Hill“, ein Jahr zuvor erschienen. Ich legte das Tape direkt in meinen Walkman. Musik, die den Gang stolzer und federnder macht. „Yo Hip Hop started out in the heart“. Ich fühlte mich unfassbar cool und frei und im Fluss. Lower Eastside, Washington Square Park, Broadway, Central Park, Harlem. Walk and listen, dance and glow. Lauryns Stimme trug mich. New York lud mich mit Energie auf. Tagsüber erlief ich mir vor Glück fast platzend alleine die Stadt. Nachts ging ich mit Leuten aus, die ich im Hostel kennengelernt hatte. Und jedes Mal, wenn ich ein teures Bier für fünf Dollar in einer Bar trank, prostete ich Onkel Heinrich kurz zu.
9: „United“ von Phoenix
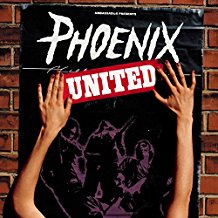 Frühjahr 2004: Ich traf ihn auf dem Phoenix-Konzert. Die Band war gerade mit ihrem zweiten Album „Alphabetical“ auf Tour. Aber die Indie-Gemeinde war geschlossen angerückt wegen des Debüts „United“ aus dem Jahr 2000. Der Song „If I Ever Feel Better“ war für mich damals der leichteste und lässigste Pop-Song des Planeten. Locker geschlagene Sahne unter der Discokugel. Er schaute mich an. Ich schaute zurück. Er zeigte auf mich und zwinkerte. Er sah toll aus. Melancholisch, schlitzohrig. Ich drehte mich um, wie in einem schlechten Film, ob nicht jemand hinter mir gemeint sei. Wir mussten lachen. Wir meinten uns. Zusammen gingen wir damals viel in die Clubs im Nobistor-Komplex. Weltbühne, Phonodrome. Und Echochamber. Mit Blick auf das Ende der Reeperbahn hatten DJ Marco und Benny mit ihrem Revolver Club ein lauschiges Zuhause für all die beautiful common people geschaffen. Der Mann und ich mitten drin. „Can’t you hear it calling – oh yeah / Everybody’s dancin‘ – oh yeah“. Too Young. Silvester 2015 mussten die Nobistor-Clubs schließen. Einige Monate später machte auch unsere Liebe dicht. Not my Sommermärchen 2006. Er brach mir das Herz, ich ihm nicht die Beine. Zu Phoenix tanze ich wieder gerne. Hat aber eine Weile gedauert.
Frühjahr 2004: Ich traf ihn auf dem Phoenix-Konzert. Die Band war gerade mit ihrem zweiten Album „Alphabetical“ auf Tour. Aber die Indie-Gemeinde war geschlossen angerückt wegen des Debüts „United“ aus dem Jahr 2000. Der Song „If I Ever Feel Better“ war für mich damals der leichteste und lässigste Pop-Song des Planeten. Locker geschlagene Sahne unter der Discokugel. Er schaute mich an. Ich schaute zurück. Er zeigte auf mich und zwinkerte. Er sah toll aus. Melancholisch, schlitzohrig. Ich drehte mich um, wie in einem schlechten Film, ob nicht jemand hinter mir gemeint sei. Wir mussten lachen. Wir meinten uns. Zusammen gingen wir damals viel in die Clubs im Nobistor-Komplex. Weltbühne, Phonodrome. Und Echochamber. Mit Blick auf das Ende der Reeperbahn hatten DJ Marco und Benny mit ihrem Revolver Club ein lauschiges Zuhause für all die beautiful common people geschaffen. Der Mann und ich mitten drin. „Can’t you hear it calling – oh yeah / Everybody’s dancin‘ – oh yeah“. Too Young. Silvester 2015 mussten die Nobistor-Clubs schließen. Einige Monate später machte auch unsere Liebe dicht. Not my Sommermärchen 2006. Er brach mir das Herz, ich ihm nicht die Beine. Zu Phoenix tanze ich wieder gerne. Hat aber eine Weile gedauert.
10: „Carrie & Lowell“ von Sufjan Stevens
 Mitte der Nuller-Jahre fing ich verstärkt an, über Pop zu schreiben. Der professionelle Blick verschob das Hören. Block und Stift zwischen Bühne und mir wie ein Filter. Umso wichtiger, immer wieder einfach Fan zu sein. Ohne Auftrag auf Konzerte zu gehen. Ohne Story im Hinterkopf. Wie beim Primavera Festival 2011 in Barcelona. Wir waren angereist, um die Reunion von Pulp zu erleben. Inmitten von herbei gepilgerten Mancunians standen wir in der lauen Sommernacht und schrieen Jarvis Wort für Wort seine Lyrics entgegen: „It doesn’t make no sense, no / It’s not convenient, no“. Doch völlig freigeschwemmt hatte mich zuvor der Auftritt von Sufjan Stevens. Kaum war der erste Ton seiner Folkpopfantasien erklungen, weinte ich los. Rotz und Wasser. Bis zur Zugabe. Er hatte einen tief verborgenen Schalter umgelegt und alles Versteckte floss hinaus. Ein schönes, befreiendes Heulen. Und bis heute ist seine Musik immer da. Ich singe und schreibe zu ihr. Ich bin dankbar, dass sie wieder und wieder und weiter berührt. So wie auch sein neuntes Studioalbum „Carrie & Lowell“ von 2015, meine wohl am meisten gehörte Platte der vergangenen Jahre. Thank you for the music.
Mitte der Nuller-Jahre fing ich verstärkt an, über Pop zu schreiben. Der professionelle Blick verschob das Hören. Block und Stift zwischen Bühne und mir wie ein Filter. Umso wichtiger, immer wieder einfach Fan zu sein. Ohne Auftrag auf Konzerte zu gehen. Ohne Story im Hinterkopf. Wie beim Primavera Festival 2011 in Barcelona. Wir waren angereist, um die Reunion von Pulp zu erleben. Inmitten von herbei gepilgerten Mancunians standen wir in der lauen Sommernacht und schrieen Jarvis Wort für Wort seine Lyrics entgegen: „It doesn’t make no sense, no / It’s not convenient, no“. Doch völlig freigeschwemmt hatte mich zuvor der Auftritt von Sufjan Stevens. Kaum war der erste Ton seiner Folkpopfantasien erklungen, weinte ich los. Rotz und Wasser. Bis zur Zugabe. Er hatte einen tief verborgenen Schalter umgelegt und alles Versteckte floss hinaus. Ein schönes, befreiendes Heulen. Und bis heute ist seine Musik immer da. Ich singe und schreibe zu ihr. Ich bin dankbar, dass sie wieder und wieder und weiter berührt. So wie auch sein neuntes Studioalbum „Carrie & Lowell“ von 2015, meine wohl am meisten gehörte Platte der vergangenen Jahre. Thank you for the music.
